Joachim Ernst Berendt´s Faschismus-These von 1976, revisited
in SWR2 Jazz Spezial: 50 Jahre ECM - ein legendäres Plattenlabel, 23.11.2019
Der Vorgang liegt über 40 Jahre zurück.
Aber, nicht nur im Zusammenhang von „50 Jahre ECM“ bietet sich an, noch einmal darauf zurückzukommen - sondern auch weil das wohl wichtigste deutschsprachige Jazzbuch des Jahres 2019 dieser Tage daran erinnert:
in „Play your-self, man! Die Geschichte des Jazz in Deutschland“ schreibt
Wolfram Knauer:
ZITAT WOLFRAM KNAUER
Die interessanteste Diskussion wurde 1976 von Joachim-Ernst Berendt losgetreten, der ganz plötzlich eine enorme Skepsis all dieser neuen musikalischen Schönheit gegenüber entwickelte, weil sie das Publikum einzulullen schien, statt es zu neuen Ufern musikalischer Erkenntnis zu tragen.
Wolfram Knauer liefert heute eine sehr interpretierende Zusammenfassung.
Er versucht, noch einmal die Jazz-Landschaft Mitte der 70er Jahre auszuleuchten, die Stellung von Joachim Ernst Berendt darin und: wie dessen
Essay damals von vielen aufgefasst wurde.
ZITAT WOLFRAM KNAUER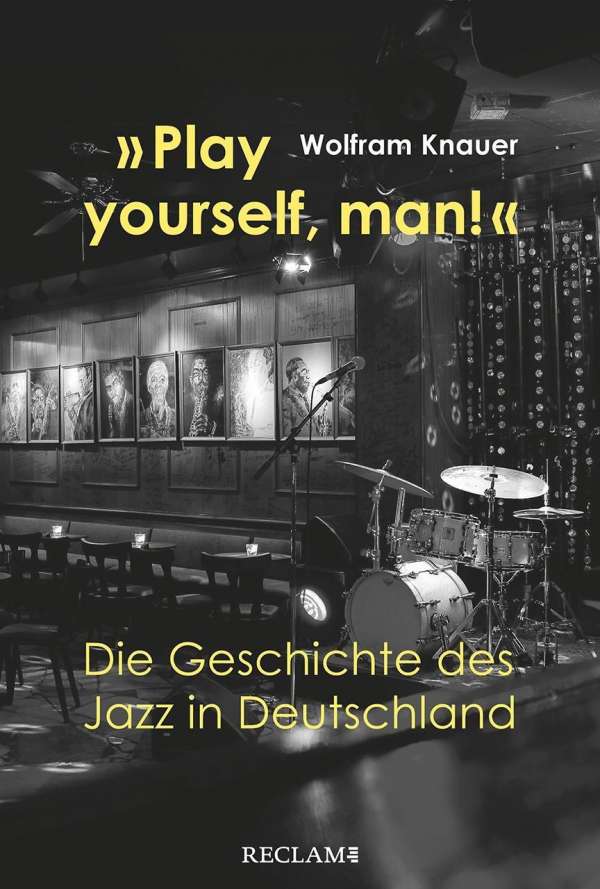
In einem Essay fürs Jazz Podium wandte er sich nicht etwa gegen den Jazzrock, mit dem amerikanische Stars mittlerweile kleine Stadien füllten.
Seine Skepsis galt stattdessen den akustischen Projekten, die nach Jarretts Köln Concert so in Mode gekommen schienen, ihrer ruhigen, teils gar kam- mermusikalischen Ästhetik und dem Schönklang, den neben Jarrett auch Corea, Hancock, McLaughlin, Brüninghaus, Garbarek und viele andere pflegten.
Insbesondere irritierte ihn Jarretts Erfolg mit einer Musik, in der kein Platz mehr zu sein schien für Klangexperimente, für insbesondere harmonisch ungebundene Improvisation, für die Suche nach neuer Form durch das Aufbrechen von Melodik, Rhythmik oder Harmonik.
Die stundenlangen Klavierimprovisationen arbeiteten zwar durchaus mit thematischem Material, vor allem aber mit Versatzstücken, mit Klischees, die Abstraktion, harmonische Verweise auf das 19. Jahrhundert, betörende Wiederholung, wie sie etwa zur selben Zeit auch in der Minimal Music zu finden war, und den Geist Bill Evans’ in sich vereinten und das Publikum im Sturm eroberten.
Berendt´s Essay erscheint in der Januar-1976-Ausgabe des deutschen Magazins Jazz Podium unter dem Titel:
„Schönheit, die ich meine. Der neue Faschismus in Jazz und Rock“.
Obwohl der Begriff „Faschismus“ damals gebräuchlicher war als heute -
viele erinnerten sich noch an die Debatten der 60er Jahre - im Zusammenhang mit „Schönheit“, mit „Jazz“ und „Rock“ war er auch damals eine Ungeheuerlichkeit.
Wolfram Knauer tut also 40 Jahre später gut daran, noch einmal den biografischen Hintergrund des Autors heranzuziehen.
ZITAT WOLFRAM KNAUER
Berendts Kritik am Schönklang im Jazz der 1970er Jahre ist dabei aus verschiedenen Perspektiven heraus zu verstehen. Zum einen war es eine sehr persönlich empfundene Abwehr gegen die Rituale des Faschismus, die er selbst ja als Jugendlicher im Dritten Reich miterlebt hatte, gegen das Pathos der Feierlichkeit, der eher ruhigstellt als aufwühlt. Zum zweiten wandte er sich gegen das von ihm so empfundene Ungleichgewicht, bei dem »Schönheit« im Vordergrund stand und dabei andere Kriterien – »gesellschaftliche und politische Relevanz, Humanität, Tiefe, Mehrdeutigkeit, Zeit als vierte Dimension, ›Rhythmus als geistige Kategorie‹, Perspektive« – in den Hintergrund drängte.
Joachim Ernst Berendt (1922-2000) war zwanzig, als er 1942 zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Sein Vater, der evangelische Pfarrer Ernst Berendt, starb im gleichen Jahr im KZ Dachau.
Der Sohn weist häufig darauf hin.
1977 erscheint der Essay auch in seinem Buch „Ein Fenster aus Jazz“,
erweitert um eine Nachschrift.
Und darin macht er deutlich, dass für ihn, Joachim Ernst Berendt, auch
in den 70er Jahren die Nazizeit noch nachklingt.
ZITAT JOACHIM ERNST BERENDT
Wer möchte schon etwas gegen Einfachheit, Natürlichkeit, Stärke, Schönheit haben?
Was ich aber nicht übersehen kann, ist die Bedeutung, die diese Worte im Deutschland der dreißiger Jahre gewonnen haben, ist das, was sie damals assoziierten.
Und natürlich auch das, was sie ausschlossen: Weltoffenheit, Toleranz, Urbanität, Bewußtheit, Humanität.
Joachim Ernst Berendt erwähnt in diesem Zusammenhang vor allem die Werke der Regisseurin Leni Riefenstahl, zum Beispiel ihre Filme über den Reichsparteitag in Nürnberg und über die Olympischen Spiele 1936.
So schwer uns Nachgeborenen fallen mag, die persönlich-biografische Herleitung für seinen Faschismus-Vorwurf nachzuvollziehen - es lassen sich durchaus objektive Belege dafür heranziehen.
So schreibt zum Beispiel der Politikwissenschaftler Peter Reichel 1991 in seiner Studie „Der schöne Schein des Dritten Reiches. Gewalt und Faszination des deutschen Faschismus“:
ZITAT PETER REICHEL
Das Dritte Reich hatte ein Doppelgesicht: Es war zugleich extrem menschenverachtend und extrem schönheitsbedürftig. Der NS-Staat beruhte ebenso sehr auf exzessiver und verheerender Entfesselung von Gewalt wie auf virtuoser Selbstdarstellung und imponierender Inszenierung seiner Macht. Er versetzte die Massen nicht nur in Angst und Schrecken, er begeisterte sie auch.
Zwischenmusik MAHAVISHNU ORCHESTRA, Hope
„Schönheit die ich meine. Der neue Faschismus in Jazz und Rock“, so lautete die Überschrift des Essays von Joachim Ernst Berendt in der Januar-1976-Ausgabe des Magazines „jazz podium“.
Wie gesagt, ein Jahr später, übernimmt er den Text in sein Buch „Ein Fenster aus Jazz“, verändert aber den Titel in „Die neue Faschistoidität in Jazz und Rock und überall“.
„Faschismus“ wird also herabgestuft zu „Faschistoidität“, mithin zu einer Faschismus-Ähnlichkeit.
In beiden Texten beklagt er den damaligen Zustand der Jazzmusik:
Vom Aufbruch der 60er Jahre sei wenig geblieben, lediglich die Öffnung zur Musik der nicht-westlichen Welt.
ZITAT JOACHIM ERNST BERENDT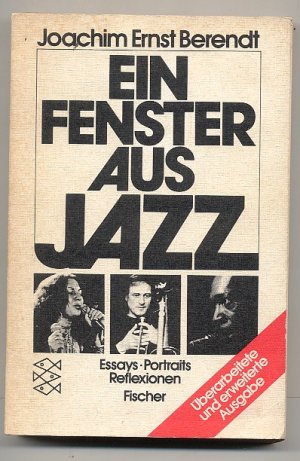
Insgesamt währte der Aufbruch nicht einmal 10 Jahre. Er ist heute zurückgenommen - fast auf der ganzen Breite - rhythmisch, harmonisch, formal, samt allen außermusikalischen Implikationen: rassisch, gesellschaftlich, politisch. Und man weiß, was da vom Jazz gesagt wird, gilt weit über ihn hinaus. Nur wird es - wie ja öfter in diesem Jahrhundert - am Jazz besonders deutlich.
(…) Was trat an seine Stelle?
Man kann es - bei aller Ironie der Situation - nicht besser sagen als in den Worten der Riefenstahl: Schönheit, Gesundheit, Harmonie, Glück…
Das Wort „Schönheit“ spielte praktisch, so lange es Jazz gibt, bei Musikern und Kritikern, von drei, vier Ausnahmen abgesehen, keine Rolle; es war kein Terminus, auf den man sich hätte einigen können.
Seit dem Anfang der 70er Jahre kommt niemand mehr ohne dieses Wort aus.
Volker Kriegel über John McLaughlin, Ray Townley über Herbie Hancock, zahlreiche Kritiker der Berliner Jazztage über Jasper van`t Hof, ich selbst - wenn ich mich einschließen darf - über Keith Jarrett, Shoichi Yui über Chick Corea…, was sie auch konstatieren mögen, immer wieder wird das Wort „Schönheit“ notwendig.
Das ist die zentrale These von Joachim Ernst Berendt. Er schlägt damit einen weiten Bogen: von Leni Riefenstahl in den 30er Jahren bis in den Jazz der 70er.
Und das ist die Konsequenz seiner Überlegungen, wiederum in seinen eigenen Worten:
ZITAT JOACHIM ERNST BERENDT
Die Kraft, die Schönheit, die Freude, die Gesundheit die Robustheit, die Natürlichkeit (…) das alles ist latent faschistisch.
Zwischenmusik KEITH JARRETT, Köln Concert IIc
Joachim Ernst Berendt: „Schönheit…ist latent faschistisch“.
Das war damals, und das ist auch heute noch deftige Kost.
Auch auf die Gefahr hin, überheblich zu wirken: ich halte diese These für grundfalsch, nichts an ihr lässt sich belegen.
Joachim Ernst Berendt begeht mehrere Denkfehler. In allen seinen Schriften zählt dazu der wenig reflektierte, der a-historische Umgang mit Analogien.
„Schönheit“ bei Leni Riefenstahl bedeutet etwas völlig anderes als „Schönheit“ bei Keith Jarrett. Der Begriff mag gleich klingen - er bezeichnet jeweils sehr Verschiedenes.
Geradezu schreiend ist ein anderer Fehler durch Analogiebildung, wie er sich im folgenden Zitat zeigt:
ZITAT JOACHIM ERNST BERENDT
Die Schwarzen - und überhaupt die Jazzleute, auch die weißen die ja im selben Boot sitzen - sprechen von roots, von Wurzeln. Die Nazis sprachen von „Blut und Boden“. Man kann bis in Einzelheiten zeigen, wie beides einander entspricht - die „roots“ und der „Blut und Boden“.
Entschuldigung, das ist so plump, dass sich darüber nicht zu diskutieren lohnt. Zumal Berendt - nicht wortwörtlich, aber dem Gedanken nach - zwei Seiten später sich selbst widerspricht:
ZITAT JOACHIM ERNST BERENDT
Das eben unterscheidet den schwarzen Blues, die Musik der schwarzen Gettos Amerikas, von der der erfolgreiche zeitgenössische Rock herkommt, von eben dieser Rock-Musik: die Humanität, die Toleranz, die Bereitschaft zum Mitleiden.
Zwischenmusik JAN GARBAREK…Belonging
Problematisch bei Joachim Ernst Berendt erscheint mir auch die Vorstellung, im Jazz die Abbildung gesellschaftlicher und politischer Vorgänge ablesen zu können.
Diese Haltung ist ein Evergreen insbesondere der deutschen Jazzpublizistik, sie hält sich bis heute.
Bei Berendt klingt sie 1976 so:
ZITAT JOACHIM ERNST BERENDT
Und man weiß, was da vom Jazz gesagt wird, gilt weit über ihn hinaus. Nur wird es - wie ja öfter in diesem Jahrhundert - am Jazz besonders deutlich.
In der Nachschrift zu seinem Essay, veröffentlicht im Buch „Ein Fenster aus Jazz“, verteidigt sich Joachim Ernst Berendt gegen die heftige Kritik daran.
Und, widerspricht sich selbst auch in obigem Punkt:
ZITAT JOACHIM ERNST BERENDT
Der Gedanke der latenten Faschistoidität, den ich nach wie vor mit Vehemenz zur Diskussion stelle, kam mir denn auch nicht bei der Musik, die ich, wie gesagt, für die hörenswerteste der zeitgenössischen Szene halte.
Er kam mir deshalb, weil mir in wachsendem Maße deutlich wurde, wie genau diese Klänge in eine kulturelle Landschaft passen, die in immer auffälligerem Maße konservativ wird.
Es kommt noch doller: diese Entwicklung, die laut Berendt zu mehr Konservativität, ja Faschistoidität strebt - sie treibt die Beteiligten willenlos vor sich her:
ZITAT JOACHIM ERNST BERENDT
Wir alle, die Musiker, die Produzenten, die Geschäftsleute, die Fans, unterliegen einer Entwicklung, die mit uns geschieht, ob wir es wollen oder nicht - ja, was noch schwerer wiegt: ob wir es wissen oder nicht.
Wir alle sind sozusagen „faschistoid wider Willen“.
Entschuldigung, das ist kein ernstzunehmendes Argument, das ist nichts als Spökenkiekerei, das ist Humbug.
Zwischenmusik CHICK COREA What game shall we play today?
Nun werden Sie fragen: was hat das alles mit ECM zu tun?
Tatsache ist: der Name „Keith Jarrett“ taucht in dem Essay von Joachim Ernst Berendt drei Mal auf, der seines Produzenten „Manfred Eicher“ einmal - jeweils ohne dezidiert negatives Vorzeichen.
Gleichwohl wurde der Text damals von vielen aufgefasst als gegen die Klangästhetik von ECM und gegen seine Künstler gerichtet. Auch bei Wolfram Knauer klingt heute wieder diese Lesart an.
Daß einiges an Plausibilität für diese Interpretation spricht, zeigt sich wenige Jahre später, 1980, als Joachim Ernst Berendt in einer mehrteiligen Radioreihe den Jazz der 70er Jahre bilanziert.
In einer dieser Sendungen kontrastiert er die in der Tat extrem unterschiedlichen deutschen Schallplattenlabels ECM und FMP.
Und lässt seine Hörer nicht im Umklaren, wem seine Sympathien gehören.
Auch hier taucht das „Schönklang-Argument“ wieder auf, freilich - und das ist bedeutend - ohne die Faschismus-Komponente.
O-TON JOACHIM ERNST BERENDT (SWF 1980) ECM hat für sich selbst die Formel gewählt „the most beautiful sound next to silence“ -
ECM hat für sich selbst die Formel gewählt „the most beautiful sound next to silence“ -
der schönste Klang nächst dem Schweigen.
Entsprechend könnte man FMP kennzeichnen mit der Formel „der freieste Sound nächst dem Schrei“.
Schönheit also und Freiheit. Schweigen. Leise. Musik und Schreien stehen einander gegenüber. Oder - um in Begriffen der modernen Kunsttheorie zu sprechen:
Ästhetisierung und eben gerade die Verdächtigung des Ästhetischen.
Verdächtigung aus guten Gründen, wie die amerikanische Essayistin Susan Sonntag wie schon Walter Benjamin in den 20er Jahren gezeigt haben.
Keine Firma der Welt hat ästhetischeren Jazz gemacht als ECM. Jazz, in dem alles oder fast alles ausgespannt ist, was unästhetisch am Jazz ist, und das ist eine ganze Menge, vielleicht gerade das, was das Bild des Jazz in der Vergangenheit weitgehend bestimmt hat.
(…) schrieb das französische Jazzmagazin über ein ECM-Festival - Jazz für Leute, die Jazz nicht lieben.
Aber, es ist noch die Frage, ob FMP Jazz macht für Leute, die wirklich „Jazz“ lieben.
Beide, ECM und FMP, sind extreme Plattenfirmen.
Vielleicht ist es auch insofern charakteristisch, dass es die beiden Firmen - ECM und FMP - gerade in Deutschland gibt. Da das deutsche kulturelle Leben seit jeher stärker als das anderer Länder durch extreme Positionen gekennzeichnet wird.
Hier haben wir sie ja wirklich: extreme Positionen.
Typisch in dieser Moderation, dass Joachim Ernst Berendt Geistesgrößen für seine Argumentation heranzieht, in diesem Falle die amerikanische Kunsttheoretikerin Susan Sonntag und den deutschen Kulturphilosophen Walter Benjamin.
Wenige Jahre später, 1983, in seinem Buch „Nada Brahma, die Welt ist Klang“, steigert Berend dieses Prinzip geradezu bis ins Virtuose.
Mein Verdacht: hier handelt es sich um Bildungshuberei, also um ein Vortäuschen von Belesenheit, um ein vordergründiges Jonglieren mit Eindruck schindenden Zitaten.
Ich habe obige Radio-Moderation von Joachim Ernst Berendt neulich einem Walter Benjamin-Experten vorgelegt. Sein Urteil fiel eindeutig aus:
er hält die Moderation nicht mehr nur für Bildungshuberei, sondern wortwörtlich für „bullshit“.
Auffällig auch der unsichere Umgang Berendt´s mit dem Begriff Ästhetik.
Er verwendet ihn nicht als Dachbegriff für alles Kunststreben, sondern nur für einen Teil daraus, für die auf „Schönheit“ gerichtete Kunst.
Zwischenmusik JOHN MCLAUGHlIN, Follow your heart
ZITAT WOLFGANG WELSCH
Wollte jemand etwa im Ernst behaupten,
in der Tragödie gehe es um Schönheit?
Das wär wirklich grotesk.
Ebenso wäre es die Auffassung,
in der Musik sei Schönheit entscheidend.
Dieser Text des Philosophen Wolfgang Welsch beschäftigt sich - darin Joachim Ernst Berendt ähnlich - gleichfalls mit der angeblichen Wiederkehr des Schönen. Er ist 2005 entstanden, fünf Jahre nach dem Tod von Berendt.
Er konnte ihn nicht kennen.
Welsch aber stellt fest: nicht die Schönheit kehrt zurück, sondern der Diskurs wählt Schönheit neu zum Thema. Bei der von Berendt losgetretenen Debatte über den Jazz der 70er Jahre könnte es durchaus ähnlich gewesen sein.
Welsch geht nicht auf Berendt ein - aber, ein anderer Philosoph tut dies 1985: Peter Sloterdijk.
Fast ein halbes Buch lang beschäftigt er sich mit dem Abschiedsband von Joachim Ernst Berendt aus dem Jazz, dem schon erwähnten „Nada Brahma - die Welt ist Klang“.
Was er dort als Berendt´s Stilmerkmale herauspräpariert, gilt auch für seine hier debattierten Texte.
Sloterdijk ist stellenweise durchaus nicht ohne Sympathie für Berendt. Aber, er urteilt eben auch:
ZITAT PETER SLOTERDIJK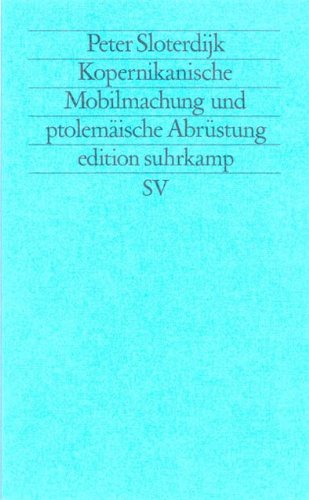
Es ist der Ernst der großen Lebensfragen,
der den Autor inspiriert und ihn beflügelt,
mehr zu sagen, als dem Experten zusteht.
Sind wir hier aufgerufen zu ergänzen:
„…mehr zu sagen, als dem Jazz-Experten zusteht“?
Ein genaues Studium der beiden Berendt-Produktionen, um die es hier geht - einmal der Faschismus-Essay, zum anderen die Radiosendung ECM kontra FMP -
ein genaues Studium beider offenbart nämlich, dass auch der Jazz-Experte Berendt sich dort nicht von seiner besten Seite zeigt.
Er zitiert gern Geistesgrößen, ja - aber er hat auch keine Hemmungen,
törichte Urteile von Kollegen zu zitieren, wenn sie ihm in den Kram passen.
O-TON JOACHIM ERNST BERENDT (SWF 1980)
ECM hat in USA nicht die einhellig gute Presse gefunden, die diese Firma in Deutschland fand. Kritiker haben gefunden, dass diese Firma ein falsches Bild vom zeitgenössischen Jazz entwerfe. Denn zum Jazz gehört eben auch Kraft und Eruptivität und auchaus auch und gerade auch das Unästhetische.
So schrieb z.B. die maßgebende amerikanische Fachzeitschrift „down beat“, dass die Vorliebe des ECM-Chefs Manfred Eicher für dünne und trockene Produktionen zu oft zu einer intellektuellen Musik führe, der es an Dynamik, persönlichen Sonoritäten, rhythmischen Fluß fehle. Mit anderen Worten: sie swingt nicht.
Das, so down beat, muss nicht notwendigerweise schlecht sein. Tatsächlich ist dies eine herausfordernde Konzeption.
Aber, sie führt unglücklicherweis zu ziemlich - tja, im Englischen heißt es „blend“, leeren, sanften und (…) den Hörer nicht wirklich einbeziehenden Platten. Zitat Ende down beat.
Ein Briefschreiber an down beat schlug vor, man solle ECM einen Preis geben „for making everyone sound the same“, also da die Firme eben gleichklingen lasse.
Was gewiß übertrieben ist. Aber, es enthält eben jenen Kern Wahrheit, auf den es in solchem Zusammenhang ankommt.
Bei allem Respekt, aber ich finde: diese Argumentation ist unredlich.
Joachim Ernst Berendt versteckt sich hinter den Urteilen amerikanischer Stimmen, die er selbst für übertrieben hält - die aber eben doch ein wenig zuträfen.
Mit anderen Worten; er wirft mit Dreck, in der Hoffnung, dass ein bißchen hängenbleibt.
ECM ist inzwischen fünfzig. Berendt sowie der unbekannte down beat-Kollege beurteilen die ersten 11 Jahre. Das sind rund 150 Produktionen:
viel Keith Jarrett, Pat Metheny, Jan Garbarek, Ralph Towner und Gary Burton; aber auch der frühe Dave Holland, Chick Corea mt seinem Circle Quartet, das Art Ensemble, Marion Brown, George Adams, Don Cherry, Dewey Redman — Musiker, die mit „Schönklang“ schwerlich zu beschreiben sind.
Man kann zu ECM-Chef Eicher stehen wie man will: es war und es ist nicht seine Aufgabe, ein „richtiges“ Bild des zeitgenössischen Jazz zu entwerfen, wie von ihm gefordert wird.
Auch Blue Note, Verve oder CBS haben damals jeweils nicht ein solches „richtiges“ Bild geliefert.
Ein „richtiges“ Bild kann sich nur aus der Summe aller zeitgenössischen Jazz-Aktivitäten ergeben.
ECM hat alles Recht der Welt, „dünne und trockene Produktionen“ auf den Markt zu bringen.
Und die Hörer haben schon damals nicht den Eindruck hinterlassen, als seien sie in diese nicht wirklich einbezogen gewesen. Die Verkaufszahlen sprachen eine andere Sprache.
Zwischenmusik RALPH TOWNER/GLEN MOORE Raven´s Wood
Schönheit die ich meine, ECM kontra FMP - man kann aus den Einlassungen von Joachim Ernst Berendt den Schluss ziehen, er habe den ästhetischen Wandel im Jazz der 70er Jahre zwar erkannt, aber nicht angemessen beschrieben.
Nicht wie ein Chronist, wie ein Journalist, sondern im Sinne einer eigenen normativen Ästhetik, die den Dingen quasi vorschreibt, wie sie zu sein haben.
Dass er an einer Stelle von der „Richtigkeit der Jazzentwicklung“ spricht, das scheint mir ein Indiz dafür zu sein.
Joachim Ernst Berendt hat der scheinbare „Schönklang“ im Jazz der 70er Jahre, vor allem verbunden mit den Produktionen von ECM, nicht gefallen.
Er hat ihn abgelehnt, mit überzogenen, ja teilweise absurden Argumenten.
Für einen Jazzpublizisten eine prekäre Lage.
Insofern ist sein Ausstieg aus dem Jazz, wenige Jahre später, nur „konsequent“,
um erneut in seinen Worten zu sprechen.
Literatur
Joachim Ernst Berendt Ein Fenster aus Jazz. Essays, Portraits, Reflexionen. Frankfurt/M 1977: S. Fischer
Wolfram Knauer
Play yourself, man!. Die Geschichte des Jazz in Deutschland.
Ditzingen 2019: Reclam
Peter Reichel Der schöne Schein des Dritten Reiches. Gewalt und Faszination des deutschen Faschismus. München, 1991: Hanser
Peter Sloterdijk Kopernikanische Mobilmachung und ptolemäische Abrüstung. Frankfurt/M 1987: edition suhrkamp
Wolfgang Welsch Blickwechsel. Neue Wege der Ästhetik. Stuttgart 2012: Reclam

